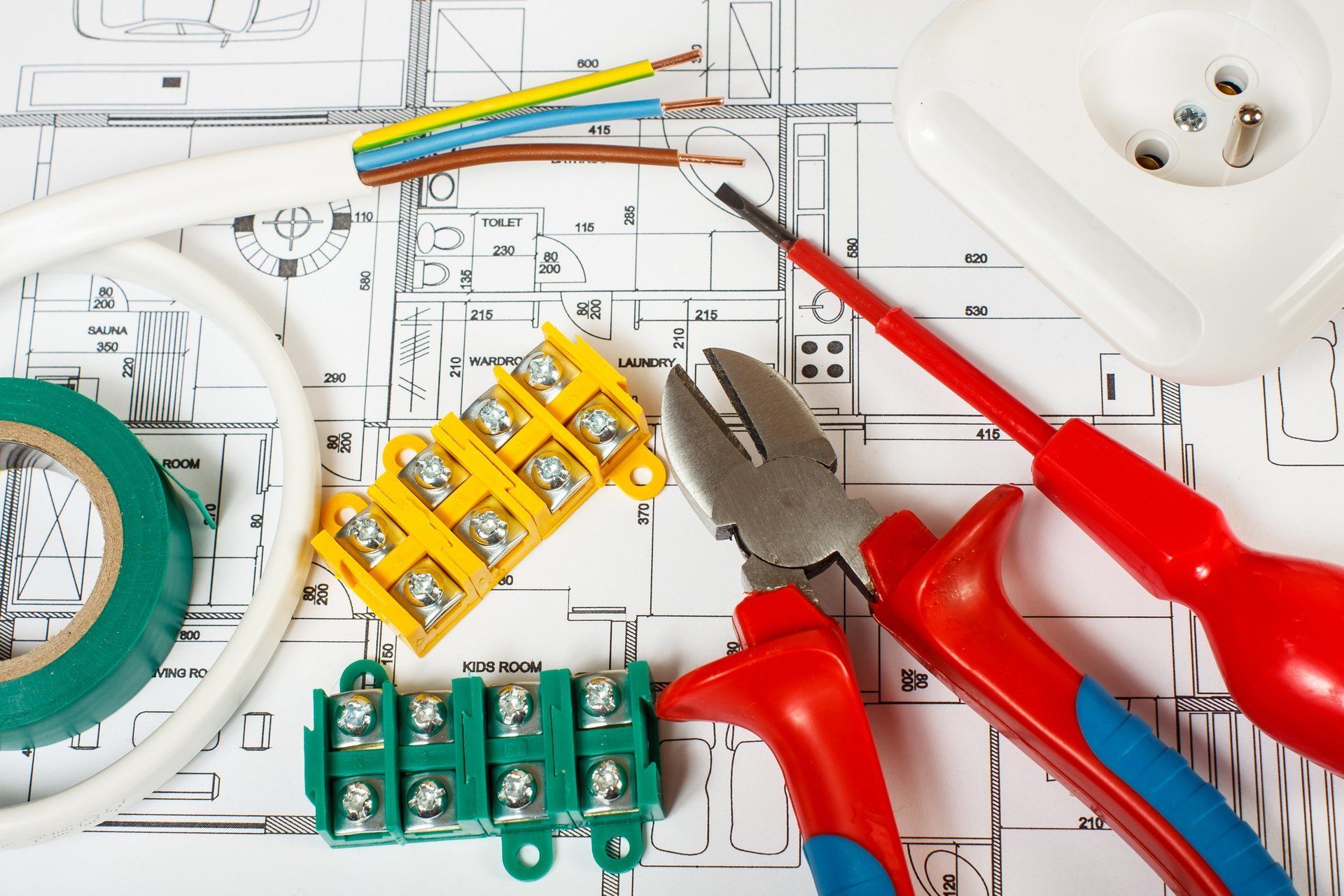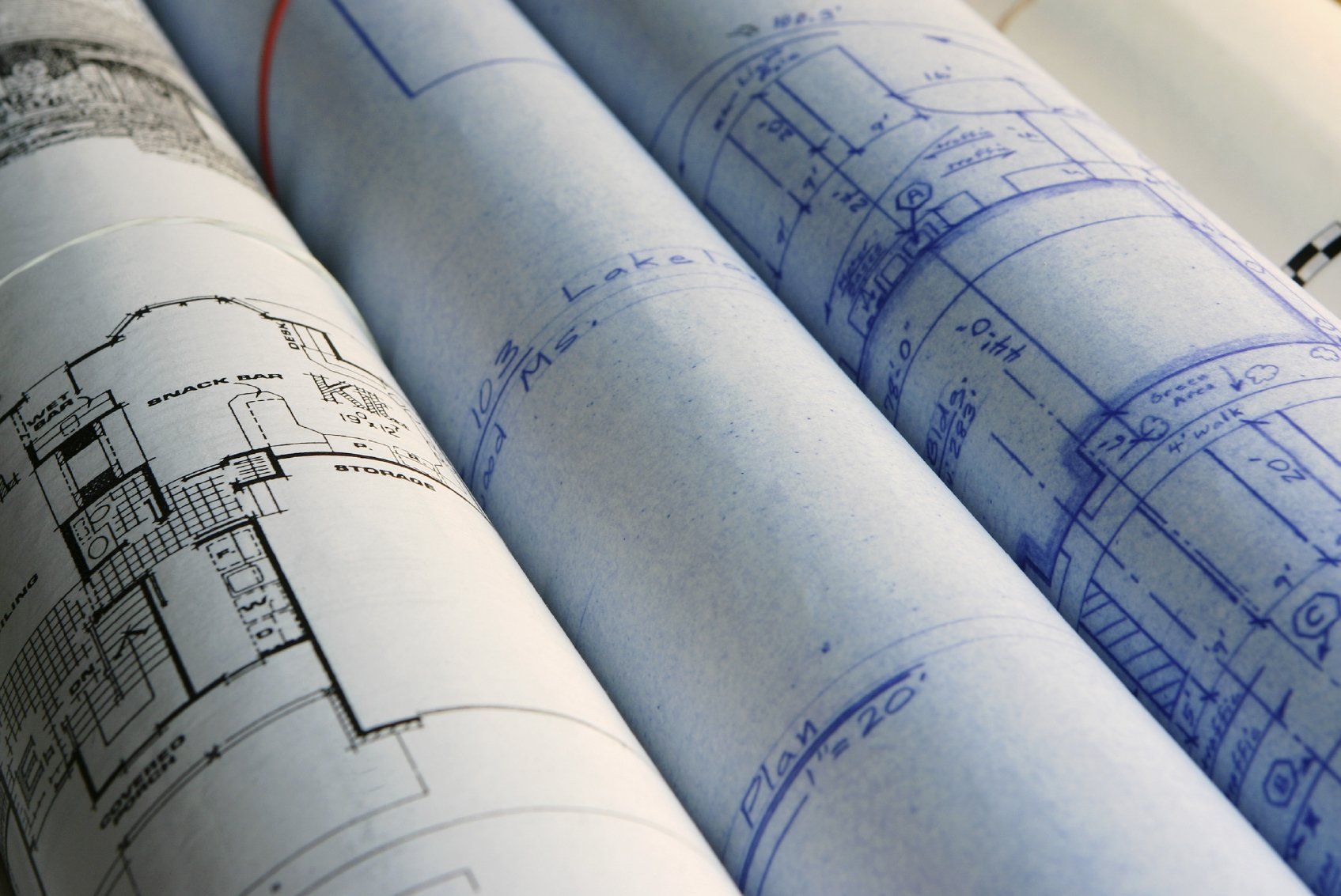Die unzumutbare Härte
Wieder einmal hatte der Bundesgerichtshof einen Fall zu entscheiden, in dem ein Vermieter wegen Eigenbedarfs gekündigt hatte und der Mieter gegenüber der Kündigung unter anderem einwandte, dass diese eine unzumutbare Härte für ihn darstelle. Der Mieter wollte damit erreichen, dass das Mietverhältnis möglichst auf unbestimmte Zeit trotz einer wirksamen Kündigung fortgesetzt wird. Der Bundesgerichtshof erkannte in dem Verfahren (Beschluss vom 26.08.2025 – VIII ZR 262/24) eine erhebliche Gehörsverletzung durch die Vorinstanzen, die dazu führen musste, die zunächst für den Vermieter streitenden Urteile von Amts- und Landgericht aufzuheben und den Rechtsstreit hinsichtlich der Härtefallregelung an eine andere Kammer des Landgerichts Berlin zurückzuverweisen.
Der Fall:
Der Mieter war im Jahr 1939 geboren und bewohnte seit 1982 eine 3-Zimmer-Wohnung in Berlin. Häufig im Jahr hält er sich für einige Tage in seinem Einfamilienhaus in Travemünde auf, wohin er jeweils mit der Bahn reist.
Die Vermieter erwarben das Grundstück im Juli 2021 und kündigten mit Schreiben vom 01. November 2021 das Mietverhältnis mit dem Beklagten wegen Eigenbedarfs. Der Beklagte widersprach dieser Kündigung und wies darauf hin, dass ein Umzug zu einer erheblichen psychischen Beeinträchtigung führen würde.
Im weiteren Verlauf führte der beklagte Mieter dazu aus, er sei aufgrund der langjährigen Mietdauer stark in das soziale Gefüge der Nachbarschaft eingebunden und hätte die Wohnung mit großem persönlichen und finanziellen Aufwand seinen Bedürfnissen angepasst, auf eigene Kosten renoviert und liebevoll eingerichtet. Unter Vorlage fachärztlicher Stellungnahmen behauptete er weiterhin, er sei gesundheitlich stark beeinträchtigt und ein erzwungener Umzug würde zu einer erheblichen psychischen Beeinträchtigung führen, verbunden mit starker, möglicherweise lebensbedrohlicher Depression, also einer suizidalen Krise. Weiterhin trug der Mieter vor, es bestehe ein hohes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko, das wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem Herzklappenfehler an der Mitralklappe liege. Tatsächlich kam es auch im Juni 2024 zu einer Zerreißung der Herzklappe und einer Herzklappenoperation.
Sowohl das Amtsgericht wie das Landgericht gaben der Räumungsklage der Vermieter statt und stützten sich dabei auf die Ausführungen eines Sachverständigen im gerichtlichen Verfahren. Außerdem waren sie der Auffassung, dass das regelmäßige Pendeln des Mieters nach Travemünde gegen die Gefahr einer gesundheitlichen Beeinträchtigung durch einen Umzug spreche. Der Bundesgerichtshof wollte diesen Wertungen insbesondere zum Vorliegen und den Wirkungen eines Härtegrundes nicht folgen und verwies die Entscheidung an eine andere Kammer des Landgerichts Berlin zurück.
Die Gründe:
Der Bundesgerichtshof erkannte in beiden Entscheidungen eine Verletzung des Anspruchs des Mieters auf rechtliches Gehör gemäß Art. 103 (1) GG, indem die beiden Vorinstanzen in dem gerichtlichen Sachverständigengutachten eine hinreichende Tatsachengrundlage erkannten, um die drohende Verschlechterung der gesundheitlichen Situation des Mieters infolge der Räumung auszuschließen. Der BGH war aber der Auffassung, dass sich in dem Sachverständigengutachten unvollständige, unzureichende und zum Teil in sich widersprüchliche Feststellungen befanden, die letztlich zu einer weiteren Begutachtung hätten führen müssen. Außerdem erkannte der Bundesgerichtshof eine Gehörsverletzung darin, dass vor allem das Berufungsgericht von einer Erhebung eines weiteren, nämlich kardiologischen Sachverständigenbeweises zu dem Ausmaß der von dem Mieter behaupteten Herzerkrankung absah.
Der BGH führte aus, dass Äußerungen medizinischer Sachverständiger von den Gerichten kritisch auf ihre Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit zu prüfen und dabei insbesondere auf die Aufklärung von Widersprüchen hinzuwirken ist, die sich innerhalb der Begutachtung eines Sachverständigen ergeben. Solche Widersprüche können zum Beispiel aus unterschiedlichen Angaben im Gutachten und in einer mündlichen Anhörung des Sachverständigen im Gerichtstermin herrühren. Vorliegend hatte der Sachverständige in seinem Gutachten unter anderem den Eintritt einer Verschlechterung der gesundheitlichen und persönlichen Situation des Beklagten einschließlich der Möglichkeit eines Suizids noch als sichere Folge einer Umfeldveränderung dargestellt. Demgegenüber erläuterte er dann im Rahmen der Anhörung vor dem Amtsgericht, dass Änderungen in der Lebenssituation des Mieters „nicht so gut wären“, aber letztlich die genauen Folgen einer Umfeldveränderung „für die Zukunft auch nicht beurteilbar“ seien. Auf die konkrete Frage, inwieweit ein erzwungener Umzug die Lebensweise des Mieters beeinflussen würde, sei „keine medizinische Einschätzung“ möglich. Da die beiden Gerichte diese offensichtliche Widersprüchlichkeit nicht hinreichend bei ihren Entscheidungen würdigten und insbesondere nicht von der Möglichkeit Gebrauch machten, nach § 412 ZPO einen weiteren Gutachter zu bestellen und mit dieser Widersprüchlichkeit zu beschäftigen, erkannte der BGH einen erheblichen Verfahrensfehler, der zur Zurückweisung des Urteils führen musste.
Eine weitere Gehörsverletzung nahm der BGH an, weil trotz der bereits gegen die Kündigung durch den Mieter eingewandten Herzinfarkt- und Schlaganfallgefahr die Gerichte keinerlei Sachverständigenbeweis erhoben, obwohl sich im späteren Verlauf des Verfahrens die Gefahr einer Herzerkrankung konkret durch die Zerreißung der Herzklappe bestätigte.
Dass der Mieter sich häufig für einige Tage in seinem Einfamilienhaus in Travemünde aufhält und hierhin selbstbestimmt trotz seines Alters jeweils mit der Bahn anreist, waren für das Amts- und Landgericht starke Hinweise dafür, dass keine unzumutbare Härte durch einen erzwungenen Wohnsitzwechsel vorliegen würde, insbesondere der Mieter gesundheitlich in der Lage sei, einen solchen Wohnungswechsel durchzuführen. Auch der Bundesgerichtshof erkannte insoweit Umstände, die gegen das Vorliegen einer unzumutbaren Härte sprechen könnten, wollte sich jedoch – anders als die Vorinstanzen – allein von diesen Umständen noch nicht davon überzeugen lassen, dass keine erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigung durch den Wohnortwechsel eintreten würde.
Da es insgesamt noch an weiteren Informationen für die Rahmen der Härtefallentscheidung nach den §§ 574 ff. BGB erforderliche Interessenabwägung fehlte, verwies der Bundesgerichtshof die Entscheidung zur weiteren Tatsachenfeststellung zurück an das Berufungsgericht.
Fazit:
Die Eigenbedarfskündigung ist eine vom Vermieter oft genutzte Möglichkeit, ein Mietverhältnis zu beenden. Unabhängig von der Kündigung ist jedoch in einem Räumungsverfahren immer auch die Frage zu berücksichtigen, ob die erzwungene Wohnungsaufgabe auf der Seite des Mieters eine unzumutbare Härte darstellt, die auch unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Vermieters dazu führen muss, dass das Mietverhältnis durch eine entsprechende Entscheidung des Gerichts auf eine bestimmte, unter Umständen sogar auf eine unbestimmte Zeit fortzusetzen ist. Im Rahmen der Beurteilung der unzumutbaren Härte kommen insbesondere gesundheitliche Beeinträchtigungen auf Seiten des Mieters in Betracht, die sich nicht immer nur in einem suizidalen Risiko, sondern zum Beispiel auch in weiteren gesundheitlichen Beeinträchtigungen, wie z. B. Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisiken, widerspiegeln können. In diesem Zusammenhang müssen die Gerichte sorgfältig und vor allem widerspruchsfrei alle Umstände ermitteln, die auf Seiten des Mieters und des Vermieters in die Interessenabwägung einfließen. Geschieht diese Ermittlung fehlerhaft, kann die Entscheidung des Gerichts erfolgreich angegriffen werden.