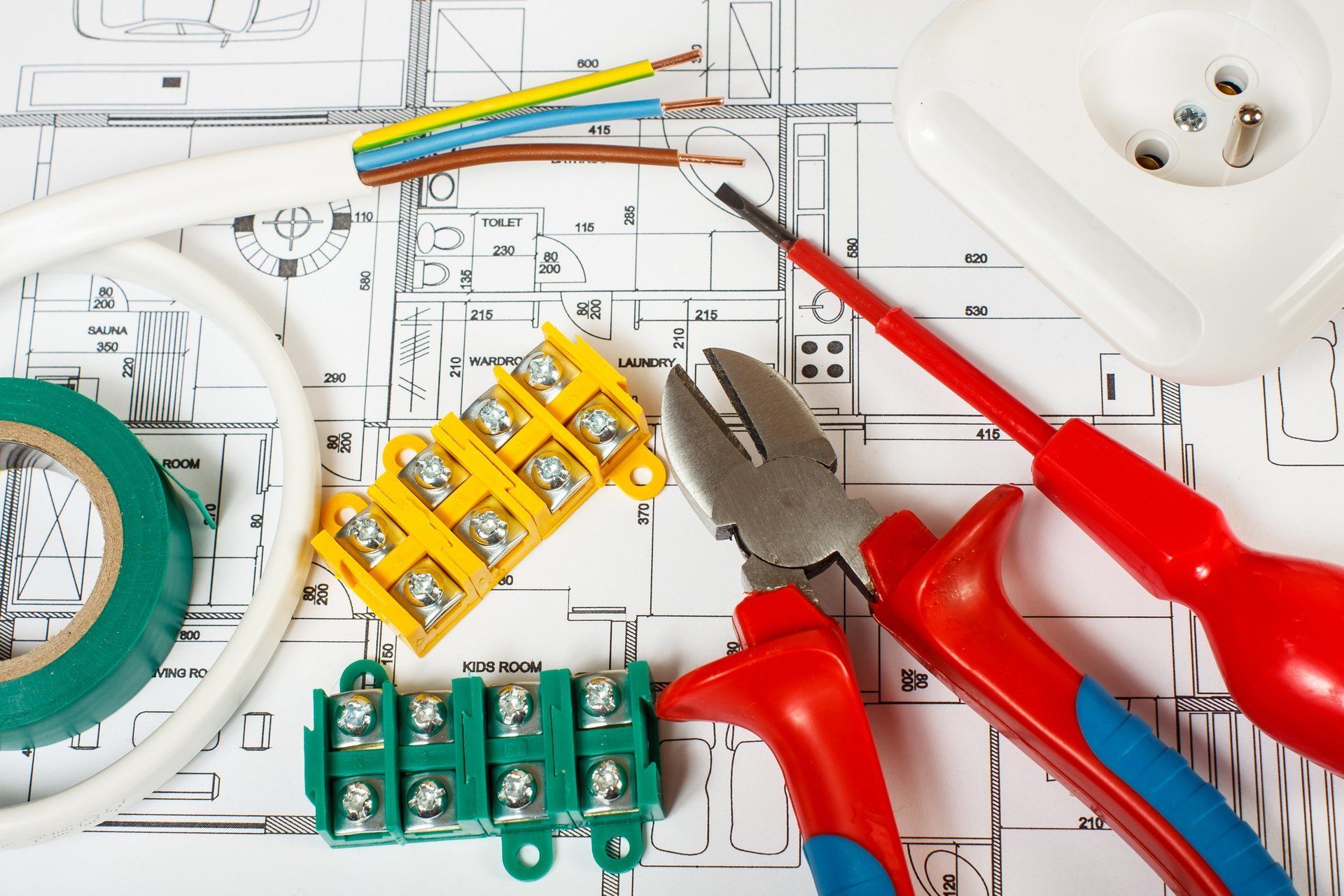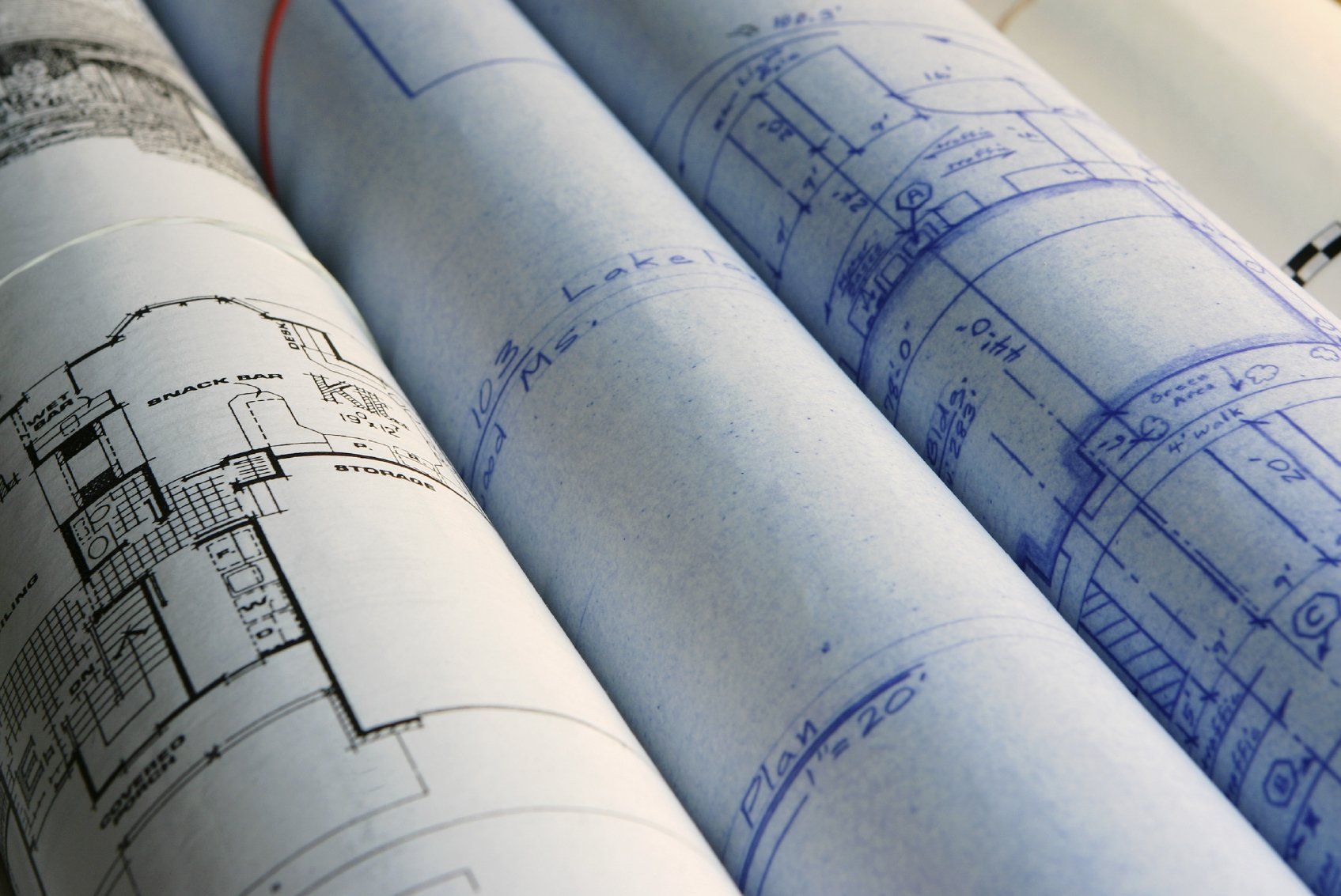Die Fassadendurchbohrung in der WEG
Árpád Farkas, Anwalt für Immobilienrecht
Einen interessanten Fall hatte der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 14.02.2025 (Az.: V ZR 86/24) zu entscheiden. Er hatte zu beurteilen, ob es eine Beeinträchtigung der Interessen übriger Wohnungseigentümer darstellt, wenn ein Wohnungseigentümer eine tragende Wand- oder die Fassade durchbohren möchte. Wie so häufig, kam es hierbei nach Auffassung des BGH auf die Würdigung aller Umstände des Einzelfalls an.
Der Fall:
Der Kläger war Mitglied der beklagten Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) und Eigentümer einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung. Im Juni 2022 beantragte er unter Beifügung eines Lichtbilds der geplanten Abdeckung, dass ihm die GdWE die Montage von vier Wohnraumentlüftungen mit außenseitig sichtbaren, farblich angepassten Abdeckungen und die hierzu erforderlichen Fassadenbohrungen mit einem Durchmesser von rund 225 mm unter Einhaltung des KfW-Standards gestattet.
Ein Stein des Anstoßes war unter anderem, dass der Kläger seinem Antrag, abgesehen von der Beifügung des Lichtbilds zur geplanten Abdeckung, keine weiteren Unterlagen beigefügt hatte. In der Versammlung der GdWE wurden Bedenken über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme auf die Bausubstanz und den KfW-Standard geäußert. Der Antrag wurde anschließend abgelehnt.
Der Kläger verlangte die Gestattung der baulichen Veränderung im Wege einer Beschlussersetzungsklage.
Die Gründe:
Während das zunächst befasste Amtsgericht die Klage als unbegründet abwies, war das mit der Berufung befasste Landgericht sogar der Auffassung, dass die Klage mangels Vorbefassung der GdWE unzulässig sei. Beide Erwägungen teilte der BGH nicht, hob
das Urteil auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an das Landgericht.
Wie viele Informationen bedarf es zur Vorbefassung?
Zunächst beantwortete der BGH die bisher in Literatur und Rechtsprechung umstrittene Frage, ob auch nach § 20 (3) WEG n. F. nunmehr für eine hinreichende Vorbefassung der GdWE erforderlich sei, dass der GdWE in diesem Zusammenhang sämtliche erforderlichen Informationen vorgelegt werden. Der BGH bestätigte insoweit seine Auffassung, die er auch im Zusammenhang mit anderen Beschlussersetzungsklagen vertrat. Danach genügt es für die Vorbefassung jedenfalls, dass der klagende Wohnungseigentümer in der Eigentümerversammlung die Beschlussfassung verlangt hat, wie er sie schließlich in der Folge von dem Gericht ersetzt verlangt. Danach liegt eine hinreichende Vorbefassung im konkreten Entscheidungsfall vor, weil der Kläger in der Eigentümerversammlung erfolglos versucht hat, eine Beschlussfassung zu erreichen, wie er sie nun mit der Klage geltend machte.
Einerseits lehnte der BGH die Erforderlichkeit der Vorlage von Informationen und Materialien ab, weil durch ein solches Erfordernis eine umfangreich materiell-rechtliche Prüfung in das Zulässigkeitsstadium der Klage vorverlagert würde. Dies ist aus Sicht des Bundesgerichtshofs mit zivilprozessualen Grundsätzen nicht zu vereinbaren. Auch ergab sich keine Notwendigkeit der Vorlage weiterer Informationen, damit die Eigentümerversammlung eine fundierte Entscheidung treffen kann. Hierbei stellte der Bundesgerichtshof insbesondere darauf ab, dass, selbst wenn zum Beispiel Sachverständigengutachten zur Entscheidungsfindung vorgelegt werden würden, diese in einem Klageverfahren ohnehin nur qualifizierter Parteivortrag wären und unter Umständen ein weiteres Sachverständigengutachten im Gerichtsverfahren erforderlich würde. Dies gilt auch, wenn wie vorliegend ein Gestattungsanspruch nach § 20 (3) WEG geltend gemacht wird und dieser für die Beurteilung der Beeinträchtigungen durch die bauliche Veränderung unter Umständen ein gesteigertes Informationsbedürfnis der übrigen Wohnungseigentümer aufweist.
Zusammenfassend stelle der Bundesgerichtshof daher klar, dass die im Rahmen der Zulässigkeit zu prüfenden Anforderungen an die Vorbefassung nicht erweitert werden dürfen durch das Erfordernis der Vorlage von weitergehenden Informationen und Unterlagen. Dies würde nämlich zu einer nicht hinnehmbaren Beeinträchtigung der Rechtsschutzmöglichkeiten des Wohnungseigentümers führen. Dieser könnte nicht sicher wissen, welche Unterlagen er der Eigentümerversammlung vorlegen muss, damit er im Anschluss eine zulässige Beschlussersetzungsklage erheben kann. Außerdem wäre für den Antragsteller vor der Beschlussfassung weder absehbar, welche Unterlagen die anderen Wohnungseigentümer für eine positive Beschlussfassung für erforderlich halten, noch könnte er vorhersehen, ob und aus welchen Gründen der beantragte Beschluss möglicherweise trotz der Vorlage umfangreicher Materialien abgelehnt werden wird. Es hätte erhebliche Verzögerungen zur Folge, wenn die Eigentümerversammlung nach Vorlage von gegebenenfalls zeitaufwendig beschafften Unterlagen die Beschlussfassung dennoch ablehnt. Zudem bestünde aufgrund der fehlenden Verwertbarkeit von Privatgutachten im Gerichtsverfahren die Gefahr, dass Gutachten zu einem Thema doppelt eingeholt werden müssten und insoweit auch doppelte Kosten entstünden.
Beeinträchtigt ein Fassadendurchbruch immer die Interessen anderer Wohnungseigentümer?
Die darüber hinaus im vorliegenden Verfahren streitige Frage, ob Fassadendurchbrüche von tragenden Wänden beeinträchtigende bauliche Veränderungen sind, die der Wohnungseigentümer nach § 20 (3) WEG nicht verlangen kann, konnte der Bundesgerichtshof mangels hinreichender Tatsachenfeststellungen der Vorinstanzen nicht treffen. Allerdings erteilte der Bundesgerichtshof der weit verbreiteten Auffassung eine Absage, wonach eine Durchbohrung der Außenwand oder des Dachs grundsätzlich eine beeinträchtigende bauliche Veränderung darstelle, mit der alle übrigen Wohnungseigentümer einverstanden sein müssten. Dieser Auffassung ist der Bundesgerichtshof ausdrücklich nicht.
Vielmehr wendet der BGH auf die Beurteilung des Begriffs „Beeinträchtigung“ seine Maßstäbe an, die er zur alten Rechtslage der baulichen Veränderung nach §§ 22 (1) 2, 14 Nr. 1 WEG a. F. entwickelt hat. Danach kommt es allein auf eine tatrichterliche Würdigung der Umstände des Einzelfalls an, ob sich andere Wohnungseigentümer durch die geplanten Durchbrüche einer tragenden Wand verständlicherweise beeinträchtigt fühlen können. Wird die Maßnahme nach fachkundiger Planung und gegebenenfalls statischer Berechnung durch ein Fachunternehmen nach den Regeln der Baukunst durchgeführt, kann es an einer Beeinträchtigung der anderen Wohnungseigentümer fehlen. Dies gilt nicht nur für tragende Innenwände, sondern auch für Außenwände (BGH, a. a. O., Rn. 22). Ob ein Wanddurchbruch oder eine Fassadendurchbohrung eine beeinträchtigende bauliche Veränderung darstellt, kann daher nur aufgrund einer fallbezogenen Abwägung der beiderseits grundrechtlich geschützten Interessen entschieden werden (BGH, a. a. O.).
Folgen für die Praxis:
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs bietet zwei wichtige Hinweise für die Praxis der Wohnungseigentumsverwaltung:
1. Zur Vorbefassung:
Verlangt ein Wohnungseigentümer die Zustimmung bzw. Gestattung einer baulichen Veränderung nach § 20 (3) WEG, so hat er einen entsprechenden Antrag zur Vorbefassung an die Eigentümerversammlung zu richten. Bei diesem Antrag hat er grundsätzlich keine weitergehenden Informationen oder Materialien zur Verfügung zu stellen. Er muss allein entscheidendes Augenmerk darauf stellen, dass der Gestattungsantrag, so wie er ihn notfalls gerichtlich weiterverfolgen will, der Eigentümergemeinschaft zur Abstimmung gebracht wird.
2. Zu Fassadendurchbrüchen:
Durchbrüche einer tragenden Wand oder Fassadendurchbohrungen können nicht ohne Weiteres als beeinträchtigende bauliche Veränderungen eingeordnet werden. Ob ein Wanddurchbruch oder eine Fassadendurchbohrung eine die übrigen Wohnungseigentümer beeinträchtigende bauliche Veränderung darstellt, und daher von diesen nicht gestattet werden muss, kann nur aufgrund einer fallbezogenen Abwägung der beiderseits grundrechtlich geschützten Interessen entschieden werden.

Der Fall: Ein Wohnungseigentümer lag im Streit mit seiner Gemeinschaft. Diese hatte für die Jahre seit 2012 keine Jahresabrechnungen mehr beschlossen. Wegen der Abrechnung für das Jahr 2019 war die Gemeinschaft sogar bereits rechtskräftig verurteilt worden, diese zu erstellen – ohne dass dies geschehen war. Als die Gemeinschaft auf Grundlage des geltenden Wirtschaftsplans die Zahlung der rückständigen Vorschüsse für die Monate Juni bis September 2022 in Höhe von über 18.000 € forderte, weigerte sich der Eigentümer. Er machte ein Zurückbehaltungsrecht geltend: Solange die Gemeinschaft ihre Pflicht zur Abrechnung nicht erfülle, werde er seine Zahlungen zurückhalten. Das Amts- und das Landgericht gaben der Zahlungsklage der Gemeinschaft statt. Sie waren der Ansicht, dass dem Eigentümer kein Zurückbehaltungsrecht zustehe. Der Eigentümer verfolgte sein Ziel jedoch weiter und legte Revision beim Bundesgerichtshof ein. Die Gründe: Der BGH bestätigte die Entscheidungen der Vorinstanzen und wies die Revision des Wohnungseigentümers zurück. Die Richter in Karlsruhe stellten unmissverständlich klar, dass das Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem Anspruch auf Zahlung der beschlossenen Vorschüsse generell ausgeschlossen ist. Die Argumentation des Gerichts stützt sich auf die besondere Natur der Vorschusszahlungen und das Finanzierungssystem der GdWE. Diese Vorauszahlungen sind das zentrale Instrument, um die laufende Liquidität der Gemeinschaft zu sichern. Sie stellen sicher, dass die für die Bewirtschaftung der Immobilie notwendigen Mittel – etwa für Energie, Versicherungen, Müllabfuhr oder Reparaturen – jederzeit zur Verfügung stehen. Würde man einzelnen Eigentümern gestatten, diese Zahlungen wegen Gegenansprüchen zurückzuhalten, könnte dies die gesamte Gemeinschaft in finanzielle Schieflage bringen. Im schlimmsten Fall drohen Versorgungssperren oder der Verlust des Versicherungsschutzes. Um diese Gefahr für die Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft von vornherein abzuwenden, sei ein Zurückbehaltungsrecht ausgeschlossen. Besonders interessant ist, dass der BGH diesen Grundsatz auch dann anwendet, wenn der Gegenanspruch des Eigentümers – wie hier der Anspruch auf Erstellung der Jahresabrechnung 2019 – unstreitig oder sogar rechtskräftig festgestellt ist. Während eine Aufrechnung mit einer titulierten Geldforderung unter Umständen zulässig sein kann (da sie die Schuld tilgt), dient das Zurückbehaltungsrecht nur als Druckmittel. Dieses Druckmittel dürfe jedoch nicht auf Kosten der Liquidität der gesamten Gemeinschaft eingesetzt werden. Dem Eigentümer, so der BGH, stehe es frei, seinen titulierten Anspruch auf Erstellung der Abrechnung im Wege der Zwangsvollstreckung durchzusetzen. Fazit: Mit dieser Entscheidung schafft der BGH Rechtssicherheit und schiebt einem gängigen Druckmittel von unzufriedenen Eigentümern einen Riegel vor. Für die Praxis bedeutet das: 1. Zahlungspflicht geht vor: Die Pflicht zur Zahlung der beschlossenen Vorschüsse ist eine der zentralen Kardinalpflichten eines jeden Wohnungseigentümers. Sie kann nicht unter Verweis auf angebliche oder tatsächliche Versäumnisse der Verwaltung oder der Gemeinschaft ausgesetzt werden. 2. Kein Zurückbehaltungsrecht: Ein Zurückbehaltungsrecht gegenüber Vorschussforderungen ist grundsätzlich ausgeschlossen, um die Handlungsfähigkeit der GdWE nicht zu gefährden. Das gilt selbst dann, wenn der Gegenanspruch gerichtlich festgestellt ist. 3. Andere Wege nutzen: Wohnungseigentümer, die ihre Ansprüche (z. B. auf Erstellung einer Jahresabrechnung) durchsetzen wollen, müssen dies über den dafür vorgesehenen rechtlichen Weg tun, also durch eine Beschlussersetzungsklage und gegebenenfalls die anschließende Zwangsvollstreckung. Ein Einbehalten des Hausgeldes ist der falsche und unzulässige Weg. Für Verwaltungen und Gemeinschaften bedeutet das Urteil eine Stärkung ihrer Position bei der Durchsetzung von Hausgeldforderungen und sichert die für eine ordnungsgemäße Verwaltung unerlässliche finanzielle Basis.